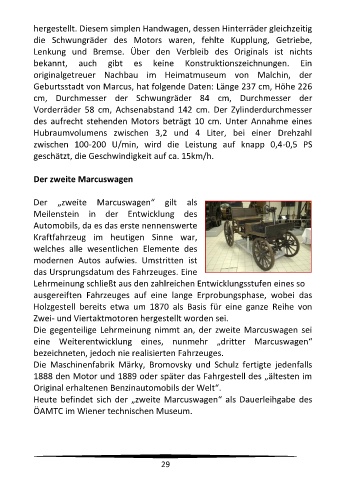Page 29 - Broschuere
P. 29
hergestellt. Diesem simplen Handwagen, dessen Hinterräder gleichzeitig
die Schwungräder des Motors waren, fehlte Kupplung, Getriebe,
Lenkung und Bremse. Über den Verbleib des Originals ist nichts
bekannt, auch gibt es keine Konstruktionszeichnungen. Ein
originalgetreuer Nachbau im Heimatmuseum von Malchin, der
Geburtsstadt von Marcus, hat folgende Daten: Länge 237 cm, Höhe 226
cm, Durchmesser der Schwungräder 84 cm, Durchmesser der
Vorderräder 58 cm, Achsenabstand 142 cm. Der Zylinderdurchmesser
des aufrecht stehenden Motors beträgt 10 cm. Unter Annahme eines
Hubraumvolumens zwischen 3,2 und 4 Liter, bei einer Drehzahl
zwischen 100-200 U/min, wird die Leistung auf knapp 0,4-0,5 PS
geschätzt, die Geschwindigkeit auf ca. 15km/h.
Der zweite Marcuswagen
Der „zweite Marcuswagen“ gilt als
Meilenstein in der Entwicklung des
Automobils, da es das erste nennenswerte
Kraftfahrzeug im heutigen Sinne war,
welches alle wesentlichen Elemente des
modernen Autos aufwies. Umstritten ist
das Ursprungsdatum des Fahrzeuges. Eine
Lehrmeinung schließt aus den zahlreichen Entwicklungsstufen eines so
ausgereiften Fahrzeuges auf eine lange Erprobungsphase, wobei das
Holzgestell bereits etwa um 1870 als Basis für eine ganze Reihe von
Zwei- und Viertaktmotoren hergestellt worden sei.
Die gegenteilige Lehrmeinung nimmt an, der zweite Marcuswagen sei
eine Weiterentwicklung eines, nunmehr „dritter Marcuswagen“
bezeichneten, jedoch nie realisierten Fahrzeuges.
Die Maschinenfabrik Märky, Bromovsky und Schulz fertigte jedenfalls
1888 den Motor und 1889 oder später das Fahrgestell des „ältesten im
Original erhaltenen Benzinautomobils der Welt“.
Heute befindet sich der „zweite Marcuswagen“ als Dauerleihgabe des
ÖAMTC im Wiener technischen Museum.
29